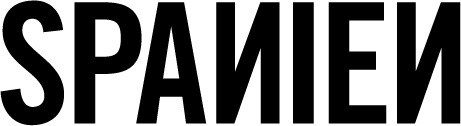
Was hat euch beide – aus verschiedenen künstlerischen Hintergründen kommend – für ein gemeinsames Projekt zusammengeführt?
Anja Salomonowitz: Ich hatte einen Dokumentarfilm über binationale Paare geplant, weil ich der Frage nachgehen wollte, wie durch die Reglementierungen der Fremdenpolizei Beziehungen unmöglich gemacht werden und die Liebe zerstört wird. Im Zuge dieser Recherche entstand die Idee zum Drehbuch einer Dreiecksgeschichte mit einem Fremdenpolizisten und seiner Ex-Frau, die eine Beziehung zu einem jungen Ausländer beginnt, die der Polizist kraft seines Amtes kaputtmachen kann. Mir war bald klar, dass ich lieber zu zweit schreiben und jemanden finden wollte, der die Figur des jungen Ausländers gut erfinden konnte. Eine Freundin empfahl mir Dimitré Dinev, ich habe ihn getroffen und wir beschlossen sehr schnell zusammenzuarbeiten.
Dimitré Dinev: In meiner Sozialisation als Künstler hat der Film eine große Rolle gespielt, ich war ein fanatischer Kinogeher. In dieser Hinsicht war es ein großes Glück, in einem kommunistischen Land aufzuwachsen,weil die Kinokultur dort sehr gepflegt wurde. Film hat mich in meiner literarischen Arbeit immer inspiriert und das Schicksal wollte es, dass mein erstes geschriebenes Werk in Österreich ein Drehbuch war. Der Film ist leider nie zustande gekommen, aber wir erhielten eine Förderung und symbolisch gesehen war es meine erste Anerkennung als selbständiger Künstler, die mir den Mut gab, weiterzumachen. Ich traute mich am Anfang noch nicht, mich in der deutschen Sprache literarisch zu betätigen. Das Drehbuch als Form hat mir die Arbeit erleichtert, da es nicht literarisch ist.
Wie ging der Prozess des gemeinsamen Schreibens konkret vonstatten?
Anja Salomonowitz: Wir haben zum ersten Mal im Sommer 2007 zusammengearbeitet und hatten dabei sehr geregelte Arbeitszeiten, da ich ein sechs Monate altes Baby hatte und mir genau einen halben Tag frei machen konnte. Wir haben keine Versionen hin- und hergeschickt, sondern sind im Büro nebeneinander gesessen und haben täglich von 9.30 bis 14.30 gearbeitet. Dimitré saß meistens denkend da, ich tippte in den Computer. Wir waren sehr diszipliniert. Einmal sagte Dimitré, „Morgen komme ich erst mittags, morgen heirate ich.“ Da haben wir dann einen Tag ausgelassen.
Inwiefern habt ihr einander ergänzt?
Dimitré Dinev: Das Schreiben ist ein Geheimnis, auch für uns selber. Auch wenn ich alleine schreibe, weiß ich nicht, wie ich geschrieben habe. Es gibt keinen Schlüssel zu einem Thema. Ich arbeite gerne mit jemandem, besonders bei Formen, die Dialog beinhalten. Das ganze Drehbuch ist im Dialog entstanden. Formell haben wir uns ein großes Ziel vorgegeben, an das wir uns gehalten haben: Alles, was sich im Bild erzählen lässt, werden wir nicht im Dialog erzählen. Wir haben für bestimmte Situationen und Zustände Bilder ersonnen und sie auf ihre Wahrhaftigkeit und Eindringlichkeit geprüft. Das war die Herausforderung und auch das Spiel: Warten wir auf das erste Wort. Dadurch, dass die Worte so rar waren, waren sie auch sehr wichtig. Jedes Wort muss etwas aussagen, das nicht im Bild ist oder auf etwas hinweisen, was später kommen wird.
Anja Salomonowitz: Nach einer ersten, ca. sieben Wochen langen Schreibphase 2007 beschlossen wir, es liegen zu lassen und haben es zwei Jahre später noch einmal überarbeitet, was eine sehr schöne Arbeit war. Dann weiß man, was funktioniert und was man weglassen kann. Das Drehbuch ist mit 62 Seiten ein ungewöhnlich kurzes Drehbuch, aber es ist alles drinnen und die Figuren sind ganz nah. Ich wollte diese Geschichte von der Fremdenpolizei mit Sehnsucht und Leben, mit etwas sehr Tiefem, durchdringen, beim Sehen dieses Filmes sollte ein Gefühl von vielen Schichten entstehen.
Die Geschichte hat mehrere Erzählstränge, die sich aber nicht im klassischen Sinne miteinander verweben, es stellt sich sogar ein zeitliches Hintereinander heraus. Welche Rolle spielte der Zufall in der Erzählung?
Dimitré Dinev: Dem Zufall haben wir keine besondere Rolle zugeordnet, vielmehr dem Unglück. Es ist eine ewige Frage, ob man das eigene Glück auf dem Unglück anderer aufbauen kann. Dem Zufall kommt keine explizite Rolle zu, außer in der Existenz des Spielers, die nur von Zufällen bestimmt wird. Ohne es erklären zu wollen, haben wir durch die Figur des Gabriel, durch diese Allegorie eines Menschen, der aufgrund seines Berufs immer über den Dächern ist und sich gleichzeitig in der tiefsten materiellen Abhängigkeit befindet, diese Art von göttlicher Vorsehung vermittelt.
Anja Salomonowitz: Es ist schon so, dass das Schicksal des einen die andere Geschichte erst auslöst. Sava fällt ja quasi vom Himmel. Ich habe es als Herausforderung betrachtet, in der Erzählung der verschiedenen Figurenstränge eine scheinbare Gleichzeitigkeit herzustellen, die sich dann als Hintereinander erweist. Dann fiel uns der Titel SPANIEN ein und ich schrieb eher zum Spaß als Untertitel aufs Drehbuch: „Ein Western von...“, ohne dass je eine Western-Geschichte von uns intendiert war. Es stimmt nur das Grundraster. Da kommt einerdurch Zufall in die Stadt, fängt sich Ärger mit dem Sheriff an, fickt dessen Frau, sucht Rache bei seinen Peinigern und verschwindet dann wieder. Er hinterlässt ein verändertes Dorf.
Es wird eine Kirche restauriert, Ikonen werden gemalt, ein Priester gewährt Sava Unterschlupf – das Religiöse hat eine Präsenz, welche?
Dimitré Dinev: Das ist so materiell wie kaum etwas anderes. Alle Transzendenz ist weggenommen. Wenn etwas göttlich ist, dann ist es das Überleben selbst.
Anja Salomonowitz: Der Priester fragt Sava, warum er nach Spanien will und Sava antwortet: „Die Menschen dort fürchten noch Gott. Wo man Gott fürchtet, kann man gut leben“. Worauf wir damit anspielen, ist folgendes: Es gab in Spanien eine Autorisierungswelle, wo illegale Migranten einen legalen Status erhielten und ich weiß auch von binationalen Ehen, die es am leichtesten hatten, in Spanien zu heiraten. Es gibt natürlich realpolitische Gründe, aber eine Erklärung könnte auch sein, dass die Menschen in Spanien die Ehe für etwas Gutes und Wichtiges halten und eine andere Moral dort haben. In Wirklichkeit sagt Sava mit diesen pseudo-religiösen Worten, dass er sich unter der gesetzlichen Lage dort besser durchschlagen kann.
Flucht, Asyl, Migration sind Themen, die in österreichischen Filmen der letzten Jahre immer wieder als Thema auftauchen. Warum hat dieses Thema eurer Meinung nach diese Virulenz?
Anja Salomonowitz: Weil die Abschiebungspolitik, die Grenzen und der Umgang mit Menschen an diesen Grenzen zur Zeit ein realpolitisches Drama darstellen. Migration ist ein Faktum, das nicht auf diese Art und Weise geleugnet werden kann. Dass das nicht zugelassen wird, spiegelt den aktuellen politischen Wahnsinn und einen unglaublichen Zynismus wider.
Dimitré Dinev: Man muss diesem Thema die Würde geben, die es immer hatte. Es gibt keinen Mythos, in dem der König nicht aus der Fremde kommt. Auch die Bibel erzählt nur Migrationsgeschichten. Das Wesentliche ist die Sehnsucht nach einem gerechten Ort, einem Ort, wo alles anders, das Leben besser ist. Diese Sehnsucht verändert die Welt und nicht die Vernunft, die immer an Grenzen stößt. In SPANIEN verfügt der Fremde über die größte Entscheidungsgewalt und sieht im Leben am klarsten. Er gibt einer verzweifelten Frau Hoffnung und Liebe und es geht auch darum hinzuweisen, dass das ganze Gebäude dieser Gesellschaft von Fremden aufgebaut worden ist. Beginnt man zu hinterfragen, von wem gewisse Gebäude stammen, dann beginnt der Monolith von einer Kultur zu zerbröckeln. Den gibt es nicht. Der Austausch treibt jede Kultur an und lässt sie überleben. Unserer Gesellschaft ist das Überleben fremd geworden und weil es fremd geworden ist, werden wir gnadenloser, ungerechter, grausamer. Das ist das Absurde, dass der Wohlstand die Menschen nicht gutmütiger macht.
Erster Film bedeutet erste Schauspielerarbeit. Wie sind Sie an diese Arbeit herangegangen?
Anja Salomonowitz: Beim Schreiben habe ich mir für Sava immer Grégoire Colin vorgestellt. Ich nahm mir zuerst vor, einen Schauspieler zu suchen, der wie er aussieht, bis ich mir schließlich dachte, warum frage ich ihn nicht selbst und er hat zu meiner großen Freude zugesagt. Er hatte das Drehbuch auf Englisch gelesen und es war vereinbart, dass er auf Deutsch spielen würde. Ich traf ihn dann in Paris, wo ich ihm das deutsche Drehbuch gab, was einen ziemlichen Schock in ihm auslöste. Ich musste ihn dann überreden, dennoch auf Deutsch zu spielen und wir haben ihm einen Coach zur Verfügung gestellt, mit dem er alles Wort für Wort auswendig gelernt hat. Darüber hinaus hat er auch Schnitzen und Vergolden erlernt, alles in allem eine sehr intensive Vorbereitung. Es gab für alle Schauspieler diese intensive Vorbereitung, weil ich das Verständnis für die Tätigkeit und das Umfeld der Figur für ebenso wichtig halte wie das Proben. Beim Casting mit Eva Roth haben wir zunächst Parameter für die Suche festgesetzt. Ich wollte so etwas wie „Herstellungsschauspieler“, d.h. Leute, die das werden können, die sich verwandeln können. Ich habe verlangt, dass die Schauspieler in die Sache richtig reingehen. Wir haben dann mehrere Wochen die Szenen erarbeitet, beim Dreh selber haben sich höchstens noch Kleinigkeiten verändert. Ich habe die Schauspielerarbeit sehr genossen, da sich eine Gemeinsamkeit eingestellt hat, die auch am Set bestehen bleibt, wo man in all dem Chaos gemeinsam eine Linie fährt.
Der Film hat eine sehr eigene Optik. Woher rührt an gewissen Orten die Stilisierung in der Ausstattung und das konsequente Durchziehen der Farbe Braun?
Anja Salomonowitz: Braun ist die Farbe der Western. Der Sand, die Erde ist braun. Braun ist der kultivierte Boden. Gewonnen für die Menschheit. In die braune Erde kann man dann die Samen werfen. Und Braun wird in der Farblehre für bodenständige Menschen verwendet. Eines der vielen Vorbilder für die Bildsprache waren Caravaggios Bilder. Die Lichtführung natürlich – aber auch die Farbgestaltung. Meine Vorgabe für die Farbwelt war Braun in Braun, Farben die sonst vorkommen durften, waren Rot, Gelb, Orange und dunkles Violett, lauter verwandte Farben. Ich wollte, dass immer alles braun ist. Nicht nur Stühle, Tisch, Wand, alles, auch der Aschenbecher und die Flasche. In dem Moment, wo die Ausstatterin und das Kostüm verstanden haben, mit welcher Konsequenz ich entschlossen war, dieses Konzept durchzuziehen, haben sie tolle Ideen gehabt und mit mir offen und intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Ich wollte ein Märchen erzählen, eine Geschichte mit Figuren, die von der Handlung und vom sozialen Kontext sehr stark in der Realität verankert sind, die aber dennoch etwas Überhöhtes, Märchenhaftes haben, was durch diese Optik unterstrichen wird.
Wie fällt jetzt, wo Sie auf Dokumentarfilm- und Spielfilmregie zurückblicken können, der Vergleich zwischen beiden Genres aus?
Anja Salomonowitz: Beim Dokumentarfilm fragt man Leute, ob sie mitmachen wollen, weil sie sind, was sie sind, und es ist oft ein schwieriger Prozess, bis sie ganz an Bord sind. Das Tolle am Spielfilm ist, dass alle unheimlich gern mitmachen und sich sehr freuen, wenn man sie anspricht. Das war ich gar nicht gewohnt. Natürlich gibt es Hürden und der Dreh ist anstrengend, aber es gibt einen Wegweiser durch das Projekt. Im Dokumentarfilm baust du ständig eine Ordnung in die Realität und ziehst dort eine Geschichte heraus, wo gar keine ist. Im Spielfilm hat man eine Geschichte vor sich. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten und jede hat etwas für sich.








